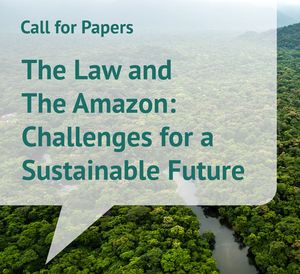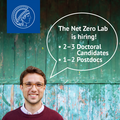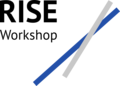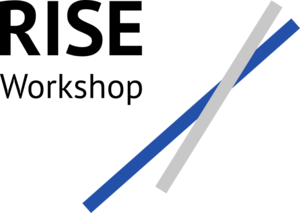Zu Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland hat Reto Hilty immer wieder mit Stellungnahmen beigetragen, wie zuletzt 2023 mit der Stellungnahme zur Initiative Zwangslizensierung von Patenten in der EU. Während der Corona-Pandemie bezog er klar Stellung zur Idee der Patentfreigabe auf Impfstoffe und erläuterte, warum eine Freigabe nicht zur besseren Versorgung mit Vakzinen führen kann.
Seit vielen Jahren leitet Reto Hilty das Projekt SIPLA – Smart IP for Latin America, das untersucht, welche Schutzstandards in Lateinamerika für die wirtschaftliche Entwicklung sinnvoll sind. Ziel der verschiedenen Einzelprojekte ist es, die Schutzsysteme so weiterzuentwickeln, dass den historischen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der unterschiedlichen Länder angemessen Rechnung getragen werden kann.
Reto Hilty, der zunächst Maschinenbau studierte, kam bereits 1989 zu einem Forschungsaufenthalt an das damalige Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München, um an seiner Dissertation zum Patentrecht zu arbeiten. Es folgten Lehraufträge an den Universitäten Zürich und St. Gallen. Nach der Habilitation zum Lizenzvertragsrecht wurde er 2001 an die ETH Zürich als Ordinarius für Technologie- und Informationsrecht berufen, 2002 folgte ein Ruf an die Universität Zürich als Ordinarius für Immaterialgüterrecht. Im gleichen Jahr wurde Reto Hilty auch als Direktor an das Max-Planck-Institut berufen.
Es folgten zahlreiche Ehren- und Gastprofessuren, etwa an der Tongji Universität in Shanghai (VR China) oder an der Singapore Management University. Die Universität Buenos Aires verlieh Reto Hilty 2019 die Ehrendoktorwürde für seine Verdienste auf dem Gebiet des Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechts.
Das Institut hat Reto Hilty aus vielen Gründen zu danken. In den vergangenen 22 Jahre hat er mit seinem Tatendrang, strategischen Scharfsinn und seinen wissenschaftlichen Leistungen das Institut geprägt, wesentlich verändert und nach vorne gebracht. Zu seinen besonders „nachhaltigen“ Initiativen zählen die Schaffung einer wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung und der unmittelbar bevorstehende Umzug des Instituts an einen neuen Standort.
Glücklicherweise bedeutet seine Emeritierung keinen Abschied vom Institut. Er möchte weiter forschen, und wird dies auch – wenn auch im Spagat zwischen Buenos Aires und München – an unserem Institut tun.