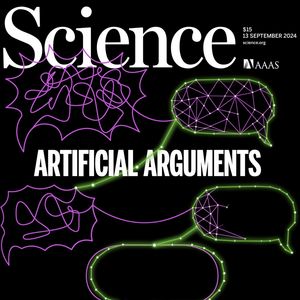Kohlenstoffmärkte spielen eine wichtige Rolle in den Klimastrategien von Unternehmen und Staaten. Sie ermöglichen den Kauf und Verkauf von Emissionsgutschriften. Diese Gutschriften repräsentieren eine bestimmte Menge an Kohlenstoffemissionen (CO2), die durch Umweltprojekte, wie Waldschutz oder die Vernichtung schädlicher Gase, reduziert oder vermieden wurden. Solche Gutschriften sind wichtig, weil sie Unternehmen und Staaten helfen, ihre Klimaziele zu erreichen, indem sie einen Teil ihrer eigenen Emissionen ausgleichen.
Das Problem
Die große Frage ist, ob diese Emissionsgutschriften wirkliche Emissionsreduzierungen widerspiegeln oder ob sie nur eine Scheinwirkung haben. Helfen diese Projekte tatsächlich der Umwelt oder zahlen wir für etwas, das keinen wirklichen Nutzen bringt? Kohlenstoffmarktprogramme ermöglichen es Projektentwicklern, durch Emissionsminderungsprojekte Kohlenstoffgutschriften zu erzielen. In mehreren Studien wurden jedoch Bedenken hinsichtlich der Umweltintegrität geäußert. Bisher fehlte eine systematische Bewertung.
Die neue Studie und die Ergebnisse
Die in Nature Communications erschienene neue Metastudie fasst nun 14 Studien über 2.346 Klimaschutzprojekte und 51 Studien über ähnliche Maßnahmen zusammen, für die keine Emissionsgutschriften ausgegeben wurden. Alle betrachteten Studien stützen sich auf experimentelle Methoden oder strenge Beobachtungsmethoden. Die Analyse deckt damit ein Fünftel der bisher ausgegebenen Emissionsgutschriften ab, was fast einer Milliarde Tonnen CO2-Emissionen entspricht.
Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass weniger als 16 % der für die untersuchten Projekte ausgestellten Emissionsgutschriften eine tatsächliche Emissionsreduzierung darstellten. Konkrete Beispiele hierfür sind:
- Bei Kochherdprojekten, bei denen herkömmliche Herde durch sauberere ersetzt werden, entsprachen die tatsächlichen Emissionsminderungen nur 11 % der ausgegebenen Emissionsgutschriften.
- Bei der Reduktion des starken Treibhausgases SF6 erreichten die tatsächlichen Emissionsminderungen nur 16 % der ausgegeben Emissionsgutschriften.
- Die Vermeidung der Abholzung von Wäldern kam auf einen Wert von 25 %.
- Die Verringerung des schädlichen Gases HFC-23 schnitt mit einem Wert von 68 % vergleichsweise gut ab.
Bezüglich der Windenergie zeigen die Daten, dass die Projekte vermutlich auch ohne den Verkauf von Emissionsgutschriften umgesetzt worden wären und dass somit die Ausgabe der Gutschriften zu keinem zusätzlichen Klimaschutz geführt hat. Auch verbesserte Waldbewirtschaftung wurde in Referenzregionen ohne Zugang zu Emissionsgutschriften im gleichen Maße umgesetzt wie auf Flächen, die von Emissionsgutschriften profitiert haben.
Bei Projekten zur Vermeidung der Treibhausgase Trifluormethan (HFKW-23) und Schwefelhexafluorid (SF6) in der Industrie zeigen die Daten aber, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem die Anlagen Zertifikate für Emissionsminderungen erhalten konnten, mehr Treibhausgase produziert wurden.
Bessere Regeln für Ausgabe von Zertifikaten dringend nötig
Dr. Benedict Probst, Leiter des Net Zero Lab und Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb betont: „Es müssen dringend bessere Regeln für die Ausgabe von Emissionsgutschriften geschaffen werden. Alle Klimaschutzprojekttypen weisen systematische Qualitätsprobleme auf. Bei der Quantifizierung der Emissionsminderungen sollte unbedingt nachgebessert werden.“
Koautor Dr. Lambert Schneider vom Öko-Institut in Berlin verweist darauf, dass es zu viele Spielräume bei der Berechnung von Emissionsminderungen gibt: „Die Regeln der Kohlenstoffmarktprogramme räumen den Projektentwicklern oft zu viel Flexibilität ein. Das kann dazu führen, dass unrealistische Annahmen getroffen oder ungenaue Daten verwendet werden, die zu einer Überschätzung der Reduktionen führen.“
Um die Qualität der Zertifikate zu verbessern, seien vor allem die Kohlenstoffmarktprogramme in der Pflicht, betonen die Autoren. Sie sollten ihre Ansätze zur Prüfung von Projekten und der Berechnung von Emissionsminderungen verbessern. Zentral sei dabei, dass konservativere Annahmen getroffen werden und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse als Grundlage dienen.
Die gesellschaftliche Bedeutung der Studie
Die großen Klimaziele sind in Gefahr: Wenn Emissionsgutschriften nicht zu einer echten Emissionsreduzierung führen, machen wir im Kampf gegen den Klimawandel nicht die Fortschritte, die wir zu erzielen glauben.
Wir riskieren ein Vertrauensproblem: Regierungen und Unternehmen verlassen sich auf Emissionsgutschriften, um ihre Klimazusagen zu erfüllen. Wenn diese Gutschriften nicht wirksam sind, könnte dies das Vertrauen in die Kohlenstoffmärkte untergraben, die als ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der globalen Erwärmung gelten.
Potenzielles Greenwashing muss vermieden werden: Einige Unternehmen könnten unwirksame Emissionsgutschriften nutzen, um zu behaupten, sie seien „klimaneutral“, ohne ihre Emissionen tatsächlich zu reduzieren, und damit Verbraucher und Regulierungsbehörden in die Irre führen.
Das Fazit
Die Studie zeigt, dass Kohlenstoffmärkte nicht die Wirkung erzielen, die sie sollen und die wir dringend brauchen. Es gibt Reformbedarf. Um wirklich etwas zu bewirken, müssen die Systeme für Emissionsgutschriften grundlegend geändert werden, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich zur Eindämmung des Klimawandels beitragen. Wenn wir diese Systeme nicht reformieren, laufen wir Gefahr, die Klimaziele zu verfehlen und Unternehmen dabei zu erlauben, sich umweltfreundlicher zu geben, als sie tatsächlich sind.
Über das Net Zero Lab
Der Umweltökonom Benedict Probst leitet seit Mai 2024 eine unabhängige Max-Planck-Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München. Ziel des Net Zero Lab ist, die Entwicklung von grünen Technologien zu beschleunigen, die für den Ersatz fossiler Brennstoffe in der Industrie entscheidend sind, sowie von Technologien, die CO2 direkt aus der Luft entfernen.
Zum Net Zero Lab: https://www.netzerolab.science/
Direkt zur Studie:
Probst, Benedict S., et al. (2024). Systematic assessment of the achieved emission reductions of carbon crediting projects, Nature Communications, 15, 9562. Verfügbar unter https://doi.org/10.1038/s41467-024-53645-z
Alle Daten in filterbaren Grafiken: https://www.carboncredits.fyi/
Weitere an der Studie beteiligte Wissenschaftler*innen und Institutionen:
Malte Toetzke (1,4), Andreas Kontoleon (3), Laura Díaz Anadón (3,5), Jan C. Minx (6,7), Barbara K. Haya (8), Philipp A. Trotter (10,11), Thales A.P. West (3,12), Annelise Gill-Wiehl (13), Volker H. Hoffmann (2)
(1) Net Zero Lab, Max Planck Institute for Innovation and Competition, (2) Group for Sustainability and Technology, ETH Zurich, (3) Department of Land Economy, Centre for Environment, Energy, and Natural Resource Governance, University of Cambridge, (4) Public Policy for the Green Transition, Technical University of Munich, (5) Harvard Kennedy School, Harvard University, (6) Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, (7) Priestley International Centre for Climate, School of Earth and Environment, (8) Goldman School of Public Policy, University of California, Berkeley, (9) Oeko-Institut, Berlin, (10) Schumpeter School of Business and Economics, University of Wuppertal, (11) Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, (12) Institute for Environmental Studies (IVM), Vrije Universiteit Amsterdam, (13) Energy & Resources Group, University of California, Berkeley.