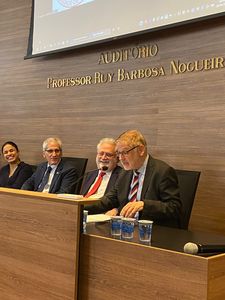Das Programm der Jubiläumsveranstaltung zeichnete die Entwicklung der Abteilung “Innovation and Entrepreneurship Research” und der Interdisziplinarität am Institut nach. Die Archiv-Meldungen zur Berufung und in der Folge Umbenennung des Instituts in „Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb“ erzählen von der Geschichte der Abteilung, auf die dabei Bezug genommen wurde.
Nach einleitenden Worten von Prof. Dietmar Harhoff, Ph.D., fand eine Podiumsdiskussion statt, in der ein Jahrzehnt an Fortschritt im Forschungsfeld und der Abteilung reflektiert wurde. Moderiert wurde das Podiumsgespräch von Dr. Zhaoxin Pu (DataGuard), die selbst 2020 ihre Promotion am Institut abgeschlossen hat und mittlerweile für ein Unternehmen tätig ist, das sich auf Datenschutz, Informationssicherheit und Compliance spezialisiert hat.
Prof. Dr. Fabian Gaessler, jetzt Assistant Professor an der Universitat Pompeu Fabra in Barcelona, sprach in seinem Beitrag darüber, wie bei der Forschung an der Schnittstelle von Management, Ökonomie, Recht und Computerwissenschaften gewissermaßen eine „Kreuzbefruchtung“ stattfände, mit einem Input von Promovierenden aus verschiedensten Institutionen und einem „Durchsatz“ von Postdocs renommierter Forschungseinrichtungen (EPFL, Cornell University, ZEW, KAIST, Northwestern University, Mines Paris Tech, University of Cape Town, Goethe-Universität u.v.a.m.). Dies qualifiziere für Positionen in verschiedensten Sektoren und habe die Ehemaligen zum einen in die Industrie, zu Start-ups und Ausgründungen (octimine technologies) oder zu EPO, bidt und anderen Forschungsinstitutionen geführt (u.a. KU Leuven, Erasmus Universität, Politecnico di Milano, Bocconi Universität, University of Groningen, Technische Hochschule Ingolstadt, Universität der Bundeswehr).
Prof. Laura Rosendahl Huber, Ph.D., die nunmehr Assistant Professor an der Rotterdam School of Management ist und u.a. zu Gender-Unterschieden forscht, zeichnete anhand von Fotos und Erinnerungen die Entwicklung der Abteilung zu einem zunehmend diversen und internationalen Team nach.
Prof. Bronwyn Hall, Ph.D., Emerita Professor der University of California Berkeley und Affiliate der Abteilung, untersuchte die Publikationszahlen der Abteilung und konstatierte eine ständig wachsende Publikationsleistung.
Dr. Matthias Lamping, Senior Research Fellow, stellte auf unterhaltsame Weise die Erwartungen der juristischen Kolleg*innen dar, die mit der Einrichtung einer ökonomischen Abteilung verbunden waren. Relativ schnell habe sich herausgestellt, dass Interdisziplinarität nicht auf Knopfdruck herzustellen sei, sondern Vorstellungen zu gemeinsamen Forschungsfragen nur über einen kontinuierlichen Dialog zusammenwachsen.
Dr. Alexander Suyer, ebenfalls ehemaliger Doktorand von Dietmar Harhoff und mittlerweile Forschungskoordinator am Institut, reflektierte entlang des Mission Statement Dietmar Harhoffs langjähriges Engagement in der evidenzbasierten Politikberatung auf nationaler und Länder-Ebene.
Prof. Dr. Josef Drexl drückte in seiner Festansprache vor allem auch Wertschätzung gegenüber der Person, dem Kollegen und Wissenschaftler Dietmar Harhoff aus.
Ausgesprochen erfrischend und beeindruckend waren die anschließenden sogenannten “Elevator Pitches”, Kurzpräsentationen von jungen Forschenden sowohl der wirtschaftswissenschaftlichen als auch der juristischen Abteilung des Instituts, die thematisch von klassischer Innovations- und Patentforschung über Genderfragen in Innovation und Entrepreneurship, Digitale Märkte, Plattformen und Künstliche Intelligenz bis hin zu Green Tech reichten und zeigten, dass der wissenschaftliche Nachwuchs im interdisziplinären Austausch gewachsen und angekommen ist.
In einem interaktiven sogenannten Memory Lane Game stellten die Junior Research Fellows Ann-Christin Kreyer und Timm Opitz schließlich überraschende, interessante und amüsante Daten und Fakten vor, bei denen das Wissen und Einschätzungsvermögen der Anwesenden gefragt waren.
Eine spezielle Überraschung wurde schließlich zum Ende der Nachmittagsveranstaltung präsentiert: Die Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watziger würdigte in einem Video-Grußwort das zehnjährige Bestehen der Abteilung für “Innovation and Entrepreneurship Research” sowie Dietmar Harhoff persönlich als “besonders einflußreiche Stimme für Innovation und Wettbewerb”, die von der Politik gehört wurde und wird.
Beim anschließenden Empfang in der großen Halle des Instituts waren die Anwesenden eingeladen, sich gewissermaßen in die Zeitmaschine zu begeben und sich die Projektposter der ersten Postersession von 2013 anzusehen, die dort aufgebaut waren, um sowohl in Bezug auf die Inhalte als auch auf die Personen den deutlichen Veränderungen und Entwicklungen der letzten zehn Jahre nachzuspüren.
Die abendliche Dinnerveranstaltung, die dem Austausch zwischen den Alumni und Alumnae der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung mit dem aktuellen Team gewidmet war, fand eingeleitet von Klavierklängen im Max-Planck-Saal des Akademischen Gesangvereins München statt, dem Max Planck seit seinem 16. Lebensjahr angehört hatte – eine weniger bekannte Facette seiner Begabungen. Dabei wurde Dietmar Harhoff von seinem Team mit einem besonderen Geschenk gedankt, das auf der Idee und Initiative von Senior Research Fellow Dr. Marina Chugunova beruht, die u.a. zu Mensch-Maschine-Interaktionen forscht: einem Bild, das von künstlicher Intelligenz generierte wurde, die mit Prompts des Teams gefüttert wurde. Dass der Mensch weiterhin unverzichtbar ist, um hervorragende kreative Ergebnisse zu erzielen, zeigte sich im Engagement von Sebastian Erhardt, auch genannt “SebGPT”, der dem Ergebnis nochmals gewaltig auf die Sprünge half.
Besonderer Dank für ihr Engagement und ihre Kreativität bei der Organisation der Veranstaltung galt Junior Research Fellow Svenja Friess.
Mehr:
Grußwort der Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger
LinkedIn-Beitrag zur Veranstaltung von Prof. Dr. Claudia Lieske (Technische Hochschule Ingolstadt)